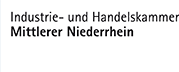Wie Sie Heizkosten im Unternehmen einsparen

Mit der neuen Serie „Energiespar-Tipps für Unternehmen“ informieren wir Sie monatlich im IHK-Magazin und ausführlich auf unserer Internetseite über Möglichkeiten, im Betrieb Energie einzusparen oder selbst zu erzeugen sowie über interessante Tools und passende Förderangebote. Das Thema dieser Folge ist die Raumwärmeerzeugung.
Die Raumwärme nimmt in Deutschland insgesamt 27,2 Prozent des Endenergieverbrauchs ein. Somit besteht für Unternehmen eine große Chance für Einsparungen.
Gesetzliche Grundlage
Mit dem Gebäudeenergiegesetz hat die Bundesregierung im Jahr 2024 festgelegt, dass neue Heizungen in Zukunft zu mindestens 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Diese Pflicht wurde verzahnt mit der kommunalen Wärmeplanung der Kommunen. Daher gilt die 65-Prozent-Pflicht in Bestandsgebäuden oder Neubauten in Baulücken ab dem 1. Juli 2026 in Städten ab 100.000 Einwohnern und ab dem 1. Juli 2028 in Kommunen bis 100.000 Einwohnern. Die Frist kann vorgezogen werden, wenn durch die nach Landesrecht zuständige Stelle unter Berücksichtigung eines Wärmeplans, der auf der Grundlage einer bundesgesetzlichen Regelung zur Wärmeplanung erstellt wurde, eine Entscheidung über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet getroffen wurde. Weitere Informationen zum Gebäudeenergiegesetz erhalten Sie hier.
Analyse
Der erste Schritt zur Optimierung des Heizwärmeverbrauchs ist eine umfassende Analyse des Status Quo. Hierzu sollten alle vorliegenden Daten zusammengetragen werden, beispielsweise Energiekostenabrechnungen, Daten von Wärmemengenzählern oder Wartungsprotokolle. Im nächsten Schritt sollten diese Daten auf Plausibilität überprüft und mit dem realen Empfinden abgeglichen werden. Passen die Verbräuche zu meinem Heizverhalten? Gibt es im Vergleich zu Daten aus der Vergangenheit Veränderungen, die nicht nachvollziehbar sind? Weichen die Daten stark von einem vorhandenen Energieausweis ab?
Tipp: Um in Zukunft eine bessere Datengrundlage für die Analyse zu haben, bietet es sich an, den Verbrauch wöchentlich zu monitoren.
Fehlersuche und Betriebsoptimierung
Sind bei der Analyse Unstimmigkeiten aufgetreten, sollten im weiteren Verlauf mögliche Ursachen identifiziert und behoben werden.
Hierzu können die Einstellungen der Heizung sowie das Nutzerverhalten anhand folgender Checkliste überprüft werden:
|
Frage / Ursache |
Mögliche Lösung |
|
Ist die Vorlauftemperatur richtig eingestellt? |
Absenken der Vorlauftemperatur und testen, ob der Wärmebedarf trotzdem gedeckt wird. |
|
Werden Räume oder Hallen bedarfsgerecht beheizt? |
Organisatorische Maßnahmen:
Technische Maßnahmen:
|
|
Werden zu beheizende Räume nicht warm? |
Ein hydraulischer Abgleich ist empfehlenswert. Er ist auch bei gewachsenen Strukturen und verändertem Nutzungsverhalten sinnvoll. |
|
Gibt es Wärmeverluste? |
Überprüfen, ob Rohrleitungen oder Speicher ausreichend gedämmt sind. |
|
Arbeiten die Heizungspumpen bedarfsgerecht? |
Überprüfen, ob Heizungspumpen mit konstanter Drehzahl laufen, oder ob sie bereits differenzdruckgeregelt und somit hocheffizient sind. |
Tipp: Die Fehlersuche und Betriebsoptimierung sollte mit einem Fachbetrieb abgestimmt werden. Es sollte eine jährliche Inspektion durchgeführt werden.
Austausch des Wärmeerzeugers
Ist der Wärmeerzeuger schon sehr alt, deutet sich ein Defekt an oder ist bereits einer vorhanden, empfiehlt es sich, sich mit technologischen Alternativen auseinanderzusetzen. Der Austausch des Wärmeerzeugers kann mit hohen Effizienzgewinnen und gleichzeitig mit einer Verbesserung des CO2-Fußabdruckes einhergehen. Der in Zukunft weiter ansteigende CO2-Preis steigert die Wirtschaftlichkeit eines Einsatzes von Heizungen auf Grundlage Erneuerbarer Energien. Einen CO2-Rechner, mit dem Sie die steigenden Kosten durch die nationale CO2-Bepresiung nachvollziehen können, finden Sie hier.
Der Austausch des Wärmeerzeugers sollte nie für sich allein betrachtet und realisiert werden, sondern immer im Kontext des im Betrieb vorhandenen Gesamtsystems. Bei der Planung einer Wärmepumpe sollte beispielsweise zwingend die bereits vorhandene Wärmeübergabe auf Eignung geprüft werden. Zudem sollten die Wärmeplanung der Kommune und die gesetzlichen Pflichten berücksichtigt werden. Unter Umständen besteht die Möglichkeit, sich in Zukunft an ein Fernwärmenetz anzuschließen und den Wärmebedarf somit ohne größere eigene Investitionen zu dekarbonisieren.
Im Folgenden werden mögliche Alternativen zu konventionellen Wärmerzeugern dargestellt:
Wärmepumpe
Biomasse / Pellets
Solarthermie
Biomethan / Biogenes Flüssiggas / Wasserstoff
Hallenheizung
Tipp: Bevor Sie sich auf einen neuen Wärmeerzeuger festlegen, überprüfen Sie die gesetzlichen Anforderungen im Gebäudeenergiegesetz und informieren sich über die Wärmeplanung Ihrer Kommune. Nehmen Sie eine Beratung in Anspruch und informieren Sie sich über Förderungen.
Förderung
Für die Optimierung oder Erneuerung Ihrer Heizungsanlage gibt es mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude zahlreiche Fördermöglichkeiten. Anbei finden Sie eine Auswahl möglicher Fördergegenstände: Wärmepumpen, Biomasseheizungen, effiziente Heizungspumpen, Erweiterung des Gebäudenetzes, Flächenheizungen, Hydraulischer Abgleich, etc. Für die Antragsstellung muss in der Regel ein bei der Deutschen Energie-Agentur gelisteter Energieberater hinzugezogen werden. Die Liste finden Sie hier.
Tipp: Planen Sie für die Antragsstellung sowie für die Förderzusage etwas Zeit ein. Wenn die Heizung aufgrund eines Defekts kurzfristig ersetzt werden muss, fehlt diese oftmals.
Beratungsmöglichkeiten
In der Regel ist es hilfreich, sich zu den zahlreichen technischen Möglichkeiten beraten zu lassen. Passende Berater finden Sie beispielsweise auf folgenden Seiten:
- www.energie-effizienz-experten.de
- www.deutsches-energieberaternetzwerk.de
- www.gih.de/energieberatung/energieberatersuche
Oder vereinbaren Sie einen Termin zur Erstberatung mit dem Effizienz-Experten der IHK.
Nächste Folge
Thema der nächsten Folge ist die Prozesswärmeerzeugung.