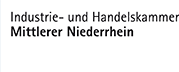Einstieg in den Import: Was Unternehmen wissen müssen

Planen Sie den Import von Waren aus Drittländern? Hier erfahren Sie, was Sie für den erfolgreichen Einstieg in den Importprozess in die EU bzw. nach Deutschland benötigen.
Voraussetzungen für die Durchführung eines Importgeschäfts
- Gewerbeanmeldung beim örtlich zuständigen Ordnungsamt
- Eintragung ins Handelsregister bei Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) oder Personengesellschaften (OHG) > Handelsregistereintragung und Firmenauskünfte
- Beantragung einer EORI-Nummer; sie muss ab dem ersten Exportvorgang bei der Ausfuhranmeldung verpflichtend angegeben werden. Sie wird bei der Generalzolldirektion beantragt: Zoll online - Beantragung einer EORI-Nummer
- Bürger aus Staaten, die nicht zur EU gehören, benötigen eine Aufenthaltsgenehmigung, die auch die Ausübung einer selbstständigen gewerblichen Tätigkeit zulässt. > Ausländerrecht III – Selbstständige Tätigkeit
Vereinbarungen geeigneter Lieferbedingungen
Das UN-Kaufrecht wurde speziell für den internationalen Warenhandel konzipiert und kommt häufig ohne ausdrückliche Vereinbarung zur Anwendung. Es regelt die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag, z.B. Lieferung, Zahlung, Vertragsverletzung und Gewährleistung. Somit gilt es als gemeinsame rechtliche Grundlage für Vertragspartner, wobei einzelne Regelungen angepasst werden können.
Während das UN-Kaufrecht den rechtlichen Rahmen für den Vertrag bildet, sorgen Lieferbedingungen für Klarheit bei der Abwicklung der Lieferung.
Bei einem Transport von Waren in Drittländer entstehen für Käufer und Verkäufer verschiedene Kosten und Risiken (Transport, Versicherung, Zoll), deren Aufteilung zwischen dem Exporteur und dem Importeur im Ausland geregelt werden muss.
Eine gesetzlich vorgeschriebene Regelung zur Kostenteilung existiert nicht. Daher sollte vor jedem Geschäft genau kalkuliert werden, welche Kosten anfallen und wer sie trägt. Die vereinbarten Lieferbedingungen legen fest, wann Kosten und Risiken vom Verkäufer auf den Käufer übergehen.
Die internationalen Handelsklauseln „Incoterms® 2020“ bieten hierzu eine klare Regelung, um diese Verpflichtungen zu definieren und Rechtssicherheit zu gewährleisten. Sie legen fest, welche Partei für die Kosten und Risiken der Lieferung verantwortlich ist. Desweiteren bestimmen sie genau, wer welche Pflichten übernimmt, je nach der vereinbarten Klausel im Vertrag. Sie sind ebenfalls anwendbar für den EU- und nationalen Handel und stellen lediglich eine Hilfestellung dar; sie müssen daher nicht zwingend angewendet werden. Auch steht es den Unternehmen frei, ältere Incoterms-Fassungen (z.B. Incoterms® 2010) zu nutzen.
Informationen zu den Incoterms und ihrer Entwicklung erhalten Sie auf der Homepage der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC).
Das offizielle Regelwerk der ICC zur Auslegung nationaler und internationaler Handelsklauseln - Incoterms® 2020 - ist als zweisprachige Ausgabe (Englisch/Deutsch) erhältlich bei der ICC Deutschland (ISBN-978-3-929621-73-0), Publ. Nr. 723 DE
Der Incoterms® 2020 Digital Guide, entwickelt von ICC, ICC Germany und der Kanzlei Luther, bietet ein interaktives Tool zur Auswahl der passenden Klausel. Der Guide ist kostenfrei verfügbar. Incoterms® 2020 Digital Guide Quelle: Incoterms® 2020 Digital Guide by ICC Germany & Luther, Dezember 2021
Vereinbarung geeigneter Zahlungsbedingungen
Ein besonders wichtiger Punkt bei der Vertragsgestaltung mit ausländischen Partnern ist die Festlegung der Zahlungsbedingungen (terms of payment). Mit den richtigen Zahlungsbedingungen können sich Exporteure und Importeure gegen zahlreiche Risiken im Außenhandel absichern.
Im internationalen Handel wird grundsätzlich zwischen dokumentärer und nichtdokumentärer Zahlungsabwicklung unterschieden. Besonders wichtig ist dabei die dokumentäre Zahlungsabwicklung, beispielsweise über Akkreditive oder Dokumenteninkasso. Zahlungsbedingungen, die von Vorkasse bis hin zu langfristigen Zahlungszielen reichen, sind flexibel und bedürfen einer individuellen Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer. Zur Sicherung von Zahlungen eignen sich Instrumente wie das Dokumentenakkreditiv.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.
Dokumente für den Import
- Handelsrechnung des ausländischen Lieferanten: Die Handelsrechnung des Lieferanten mit Angaben zu Warenbeschreibung, Menge, Preis und Zolltarifnummer dient der Verzollung und der Berechnung des Zollwerts. Sie sollte keine ausländische Umsatzsteuer enthalten.
- Zollwertanmeldung D.V.1: Die Zollwertanmeldung ist erforderlich, wenn Zoll festgelegt wurde und die Ware endgültig importiert wird. Sie entfällt bei einem Zollwert unter 20.000 Euro oder zollfreien Waren. Die Zollwertanmeldung ist online beim Zoll erhältlich.
- Ursprungszeugnisse: Für einige Waren ist bei der Einfuhr ein Ursprungszeugnis erforderlich, das der Exporteur vor dem Versand bei seiner zuständigen Behörde im Exportland beantragen muss.
- Einfuhrgenehmigungen, Einfuhrlizenzen, Einfuhrkontrollmeldungen, Überwachungsdokument: Wenn für Importprodukte Einfuhrgenehmigungen erforderlich sind, müssen sie vor dem Import beantragt werden. Genehmigungen für gewerbliche Produkte werden beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und landwirtschaftliche Produkte bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) beantragt. Ob eine Genehmigung notwendig ist, lässt sich über EZT Online oder TARIC ermitteln.
- Internationale Endverbleibserklärungen/Wareneingangsbescheinigungen:
Bei der Einfuhr von Waffen, Munition, Rüstungsmaterial, kerntechnischen Materialien und strategischen Waren (z.B. Computer, Präzisionsmaschinen) kann der Einführer eine internationale Einfuhrbescheinigung oder Wareneingangsbescheinigung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aufgrund einer Aufforderung des ausländischen Vertragspartners beantragen.
- Freihandels- und Präferenznachweise: Warenverkehrsbescheinigungen, Ursprungserklärungen, Erklärung zum Ursprung (REX), ggfs. Lieferantenerklärungen
Welche Dokumente für den Import benötigt werden können Sie u.a. über die Auskunftsdatenbank der EU Access2Markets oder über EZT Online Einfuhr recherchieren.
Beschränkungen bei der Einfuhr
Einfuhrabgaben
- Einfuhrzoll / Präferenzzoll
Neben dem Drittlandszoll können bei Einfuhren oft Präferenzzölle oder Zollbefreiungen gelten, wenn die Waren nachweislich in Ländern produziert wurden, mit denen ein Abkommen besteht oder die eine einseitige Vorzugsbehandlung erhalten (z.B. Entwicklungsländer). - Einfuhrumsatzsteuer
Bei der Einfuhr fallen grundsätzlich neben Zollgebühren auch Einfuhrumsatzsteuern an. Diese beträgt in Deutschland 19 Prozent (ermäßigt 7 Prozent). Für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen ist sie kostenneutral, da sie als Vorsteuer abgesetzt werden kann. - Verbrauchsteuern
Sie wird u.a. erhoben auf Alkohol, Tabakwaren, Kaffee und auch Mineralöl. - Antidumping- und Antisubventionszölle
Antidumping- und Antisubventionszölle werden von der EU erhoben, um Preise bestimmter Importwaren an das Marktpreisniveau anzupassen, wenn sie im Ursprungsland unter Preis verkauft oder subventioniert wurden. - Zusatzzölle und gesonderte Zölle
Bei der Einfuhr bestimmter Erzeugnisse können ebenfalls zusätzliche Abgaben anfallen, z.B. bei Agrarprodukten
Anmeldung der Ware
Dies erfolgt grundsätzlich digital über:
- das ATLAS-System (Automatisiertes Tarif- und Lokales Zollabwicklungssystem) unter Nutzung einer speziellen Software oder
- die Internetzollanmeldung
- Anmeldung von Post- und Kuriersendungen bis 150 Euro Warenwert werden über ATLAS IMPOST abgegeben (gilt nicht für Waren, die Verboten und Beschränkungen unterliegen, Verbote bestehen oder bestimmte Unterlagen der Zollstelle zur Einfuhr vorzulegen sind (Genehmigungen, Lizenzen…).
- alternativ kann die Anmeldung über einen Dienstleister in Vertretung erfolgen
Auf der Website des Zolls wird das "Merkblatt zu Zollanmeldungen, summarischen Anmeldungen und Wiederausfuhrmitteilungen" zur Verfügung gestellt.
Zudem muss die richtige elfstellige Codenummer (Waren-/Zolltarifnummer) für die Ware ermittelt werden, siehe auch Info Zolltarifnummer Es ist wichtig, auf eine korrekte Codierung zu achten, da diese mit verschiedenen Maßnahmen wie z.B. Einfuhrverboten, Beschränkungen, Zöllen und Einfuhrabgaben verknüpft ist.
Falls es Unsicherheiten hinsichtlich der Richtigkeit der Codenummer gibt, kann sie durch eine verbindliche Zolltarifauskunft (vZTA) beim Zoll geprüft werden. Für eine unverbindliche Zolltarifauskunft kann die Zentrale Auskunftsstelle der Deutschen Zollverwaltung kontaktiert werden.