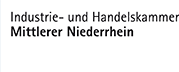Einstieg in den Export: Was Unternehmen wissen müssen

Ein Export bzw. eine Ausfuhr liegt immer dann vor, wenn eine Ware in ein Land außerhalb der Europäischen Union (Drittland) geliefert wird. Hierbei gibt es spezielle Anforderungen zu beachten.
Was gibt es grundsätzlich zu beachten?
- Gewerbeanmeldung beim örtlich zuständigen Ordnungsamt
- Eintragung ins Handelsregister bei Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) oder Personengesellschaften (OHG) > Handelsregistereintragung und Firmenauskünfte
- Beantragung einer EORI-Nummer; sie ist ab dem ersten Exportvorgang bei der Ausfuhranmeldung verpflichtend anzugeben und bei der Generalzolldirektion zu beantragen: Zoll online - Beantragung einer EORI-Nummer
- Bürger aus Staaten, die nicht zur EU gehören, benötigen eine Aufenthaltsgenehmigung, die auch die Ausübung einer selbstständigen gewerblichen Tätigkeit zulässt. > Ausländerrecht III – Selbstständige Tätigkeit
Vereinbarungen geeigneter Lieferbedingungen
Das UN-Kaufrecht wurde speziell für den internationalen Warenhandel konzipiert und kommt häufig ohne ausdrückliche Vereinbarung zur Anwendung. Es regelt die Rechte und Pflichten der Käufer und Verkäufer im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag, z.B. hinsichtlich der Lieferung, Zahlung, Vertragsverletzung und Gewährleistung. Somit handelt es sich um eine gemeinsame rechtliche Grundlage für Vertragspartner, wobei einzelne Regelungen angepasst werden können.
Während das UN-Kaufrecht den rechtlichen Rahmen für den Vertrag bildet, sorgen Lieferbedingungen für Klarheit bei der Abwicklung der Lieferung.
Bei einem Transport von Waren in Drittländer entstehen für Käufer und Verkäufer verschiedene Kosten und Risiken (Transport, Versicherung, Zoll), deren Aufteilung zwischen dem Exporteur und dem Importeur im Ausland geregelt werden muss.
Eine gesetzlich vorgeschriebene Regelung zur Kostenteilung existiert nicht. Daher sollte vor jedem Geschäft genau kalkuliert werden, welche Kosten anfallen und wer sie trägt. Die vereinbartem Lieferbedingungen legen fest, wann Kosten und Risiken vom Verkäufer auf den Käufer übergehen.
Die internationalen Handelsklauseln „Incoterms® 2020“ bieten hierzu eine klare Regelung, um die Verpflichtungen zu definieren und Rechtssicherheit zu gewährleisten. Sie legen fest, welche Partei für die Kosten und Risiken der Lieferung verantwortlich ist. Desweiteren bestimmen sie genau, wer welche Pflichten übernimmt, je nach der vereinbarten Klausel im Vertrag. Sie können auch auf für den EU- und nationalen Handel angewendet werden, sind aber lediglich eine Hilfestellung; Sie müssen daher nicht zwingend angewendet werden. Auch steht es den Unternehmen frei, ältere Incoterms-Fassungen (z.B. Incoterms® 2010) anzuwenden.
Weitere Informationen zu den Incoterms und ihrer Entwicklung erhalten Sie auf der Homepage der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC).
Das offizielle Regelwerk der ICC zur Auslegung nationaler und internationaler Handelsklauseln - Incoterms® 2020 - ist als zweisprachige Ausgabe (Englisch/Deutsch) erhältlich bei der ICC Deutschland (ISBN-978-3-929621-73-0), Publ. Nr. 723 DE
Der Incoterms® 2020 Digital Guide, entwickelt von ICC, ICC Germany und der Kanzlei Luther, bietet ein interaktives Tool zur Auswahl der passenden Klausel. Der Guide ist kostenfrei verfügbar. Incoterms® 2020 Digital Guide Quelle: Incoterms® 2020 Digital Guide by ICC Germany & Luther, Dezember 2021
Vereinbarungen geeigneter Zahlungsbedingungen
Ein besonders wichtiger Punkt bei der Vertragsgestaltung mit ausländischen Partnern ist die Festlegung der Zahlungsbedingungen (terms of payment). Mit den richtigen Zahlungsbedingungen können sich Exporteure und Importeure gegen zahlreiche Risiken im Außenhandel absichern.
Im internationalen Handel wird grundsätzlich zwischen dokumentärer und nichtdokumentärer Zahlungsabwicklung unterschieden. Besonders wichtig ist dabei die dokumentäre Zahlungsabwicklung, beispielsweise über Akkreditive oder Dokumenteninkasso. Zahlungsbedingungen, die von Vorkasse bis hin zu langfristigen Zahlungszielen reichen, sind flexibel und bedürfen einer individuellen Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer. Zur Sicherung von Zahlungen eignen sich Instrumente wie das Dokumentenakkreditiv.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausbank.
Exportkontrolle
Bei der Ausfuhr müssen verschiedene außenwirtschaftsrechtliche Beschränkungen gemäß EU- und nationalem Recht beachtet werden. Die Bestimmungen zur Exportkontrolle betreffen:
- Länderspezifische Embargos: Bei Länderspezifische Embargos handelt es sich um Handelsbeschränkungen gegen ein bestimmtes Land. Es ist zu prüfen, ob für das Zielland solche Beschränkungen bestehen.
- Den Empfänger: Steht der Empfänger auf der EU-Sanktionsliste? Die Datenbank Finanz-Sanktionsliste bietet die Möglichkeit, Personen, Gruppen und Organisationen zu identifizieren, für die aufgrund von Sanktionen ein umfassendes Verfügungsverbot (Geschäftsverbot) gilt.
- Das Gut: Handelt es sich um Güter der EU-Dual-Use-Liste oder der Ausfuhrliste und somit um genehmigungspflichtige Waren? Die Prüfung der Genehmigungspflicht erfordert technischen Sachverstand. Mögliches Hilfsmittel für die Güterlistenprüfung: Elektronischer Zolltarif sowie das Umschlüsselungsverzeichnis vom BAFA
- Den Verwendungszweck: Liegt ein kritischer Verwendungszweck vor und handelt es sich um genehmigungspflichtige nichtgelistete Güter? Auch wenn die Waren nicht auf der Ausfuhrliste oder in den Anhängen der Dual-Use-Verordnung aufgeführt sind, kann eine Genehmigungspflicht bestehen, zum Beispiel bei Kenntnis des Exporteurs über eine beabsichtigte militärische Nutzung der Ware.
In den Fällen, bei denen eine Genehmigungspflicht besteht, muss ein Genehmigungsantrag über ELANK-2 Ausfuhr-System abgegeben werden.
Auskünfte und Informationen sowie Zuständigkeit für die Feststellung der Genehmigungspflicht:
| Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) |
| Telefon 06196 908-0 |
| Internet: http://www.bafa.de |
Unter bestimmten Voraussetzungen können auch sogenannte nationale oder EU-allgemeine Genehmigungen (AGG) angewendet werden. Dabei fällt die aktive Genehmigungsanfrage über ELANK-2 weg.
Einfuhrbestimmungen des Ziellands
Bei einem Import müssen entsprechende Informationen über Einfuhrvorschriften des Bestimmungslandes eingeholt werden. Hier sollte der Importeur mit eingebunden werden und zuverlässige Auskünfte zu den Einfuhrbestimmungen zur Verfügung stellen.
Dazu zählen notwendige Begleitdokumente wie Handelsrechnungen, Ursprungszeugnisse oder auch Präferenzdokumente. Darüber hinaus müssen Unternehmen sicherstellen, dass die Waren nicht gegen Verbote oder Beschränkungen im Zielland verstoßen. Viele Länder haben spezielle Regelungen, die bestimmte Produkte verbieten oder deren Einfuhr einschränken. Dies kann auf Grund von politischen, gesundheitlichen oder sicherheitsrelevanten Bedenken der Fall sein.
Beispiele:
- Einfuhrlizenzen für Arzneimittel und Pharmazeutika
- Importgenehmigungen für bestimmte Lebensmittelprodukte
- Phytosanitärzertifikate für Pflanzen und Pflanzenprodukte
- Zertifikate zu Sicherheitsstandards
- Produktkennzeichnung für chemische Produkte
- Konformitätszertifikate usw.
Um sicherzustellen, dass die Waren den Vorschriften entsprechen, ist es wichtig, sich darüber rechtzeitig zu informieren.
Auskünfte über die zu entrichtenden Einfuhrabgaben im Importland finden Sie unter Angabe der Warennummer für die meisten Länder in der Datenbank Access2Markets. Das Portal ermöglicht es Unternehmen, mit nur wenigen Klicks Zölle, Steuern, Ursprungsregeln, Produktanforderungen, Zollverfahren, Handelshemmnisse und Handelsstatistiken zu einem bestimmten Produkt, das sie exportieren möchten, nachzuschlagen.
Das Nachschlagewerk Konsulats- und Mustervorschriften (K & M) der Handelskammer Hamburg kann ebenfalls für die Recherche von notwendigen Dokumenten herangezogen werden.
Einfuhrabgaben
Temporäre Ausfuhr
Eine temporäre Ausfuhr bezeichnet die vorübergehende Ausfuhr von Waren aus dem Zollgebiet der EU, mit der Absicht, sie nach einer bestimmten Zeit wieder zurückzuführen. Dies kann beispielsweise für Reparaturen, Messen oder Ausstellungen der Fall sein.
Bei der Wiedereinfuhr von temporär ausgeführten Waren können unter bestimmten Bedingungen Abgaben (wie Zölle oder Einfuhrumsatzsteuer) erhoben werden, wenn die Waren wieder ins Ursprungsland zurückgebracht werden. In vielen Fällen wird jedoch von der Erhebung von Einfuhrabgaben abgesehen, sofern die Wiedereinfuhr innerhalb eines festgelegten Zeitraums erfolgt und alle Bedingungen erfüllt sind.
Der temporäre Einsatz von Gütern in Drittländern erfordert oft eine Sicherheit für mögliche Importabgaben. Sie wird bei der Wiederausfuhr zurückerstattet.
Das Carnet ATA, ausgestellt von Industrie- und Handelskammern, vereinfacht die Zollabwicklung und ersetzt separate Sicherheiten im Zielland. Es gilt jedoch nur in Ländern, die dem Carnet-ATA-Abkommen angehören und greift bei besonderen Warengruppen (wie Berufsausrüstungen, Warenmustern oder Ausstellungsgütern). Für Exporte in andere Länder ist eine Ausfuhranmeldung zur vorübergehenden Ausfuhr für Rückware nötig.
Verfahren bei der Ausfuhr
Für Warenausfuhren, die einen statistischen Wert (Rechnungspreis der Ware inklusive Transportkosten bis zu DE-Außengrenze) von 1.000 Euro und/oder ein Gewicht von 1.000 Kilogramm überschreiten, ist eine elektronische Ausfuhranmeldung erforderlich. Sie muss unter Angabe der EORI-Nummer des Unternehmens über das elektronische Zollsystem ATLAS-Ausfuhr eingereicht werden.
Vereinfachung bei Kleinsendungen bis 1.000 Euro: Exporte mit einem statistischen Wert von bis zu 1.000 Euro (einschließlich Warenwert und Transportkosten bis zur DE-Außengrenze) können mündlich an der Ausgangszollstelle angemeldet werden, können aber auch auf freiwilliger Basis schriftlich erfolgen. Der Warenwert muss dabei nachgewiesen werden, was in der Regel durch die Handelsrechnung erfolgt. Die mündliche Anmeldung gilt nicht für Warenlieferungen mit genehmigungspflichtiger Ware oder in Embargoländer mit Genehmigungspflicht.
Die elektronische Anmeldung
Die Pflicht zur Abgabe einer elektronischen Ausfuhranmeldung betrifft grundsätzlich alle Ausfuhrvorgänge (Warenlieferungen in Drittländer).
Die Ausfuhranmeldung in ATLAS kann auf unterschiedliche Weise erstellt werden:
- Nutzung einer Software (vom Zoll zertifiziert und Schnittstellenfähig zu ATLAS) im Unternehmen
- Anwendung der Internetausfuhranmeldung Plus (IAA Plus) (kostenlos), benötigt wird hier ein Elster-Zertifikat.
- Durch einen Dienstleister (Spedition oder Zollagent)
Unionsrechtliche wie nationale Unterlagencodierungen müssen in der elektronischen Zollanmeldung angegeben werden, um die relevanten Dokumente korrekt zuzuordnen und die Zollvorgaben zu erfüllen. Sie sind u.a. im Merkblatt zu Zollanmeldungen, summarischen Anmeldungen und Wiederausfuhrmitteilungen - Ausgabe 2025 zu finden.
Weitere Infos zu dem Ausfuhrverfahren gibt es unter Zoll online - Ausfuhrverfahren.
Zolltarifnummer
Zolltarifnummern, auch Warentarifnummern oder HS-Codes genannt, dienen der eindeutigen Klassifizierung von Waren. Sie ermöglichen die Identifikation von Gütern, Abgabenberechnung, die Ermittlung von Maßnahmen und Erfassung statistischer Daten. Für die Ausfuhranmeldung ist die achtstellige Zolltarifnummer notwendig.
Sie muss der Ausführer ermitteln. Hilfsmittel dafür sind:
- EZT Online
- Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik vom Statistischen Bundesamt
- Für eine verbindliche Auskunft kann eine sogenannte "Verbindliche Zolltarifauskunft" (vZTA) über das Zollportal des Deutschen Zolls beantragt werden.