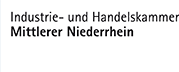Hinweisgeberschutzgesetz ist da – mit neuen Pflichten!

Das Hinweisgeberschutzgesetz wurde, nachdem es noch in der Sitzung des Bundesrates am 10.02.23 gescheitert ist, am 12.05.23 mit breiter Mehrheit verabschiedet und ist mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft getreten. Vorausgegangen waren diverse Änderungs- und Anpassungsverschläge im Vermittlungsausschuss, mit denen die bisherigen Kritiker mit ins Boot geholt werden konnten. Dies betrifft insbesondere die vom Gesetzesentwurf zunächst vorgesehene verpflichtende Einrichtung von anonymen internen Meldestellen und die fehlenden gesetzlichen Anreize, die internen Meldestellen gegenüber den externen Meldestellen zu bevorzugen.
Das Hinweisgeberschutzgesetz wird den Hinweisgeberschutz wirksam und nachhaltig verbessern, dem gesamtgesellschaftlichen Beitrag von Hinweisgebern bei der Aufdeckung und Ahndung von Missständen Rechnung tragen und für ausreichend Rechtssicherheit für die Betroffenen sorgen. Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) bringt für Unternehmen einige signifikante Neuerungen mit sich.
Anwendungsbereich
Durch das HinSchG sind natürliche Personen geschützt, die im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit über interne und externe Meldestellen Informationen und Verstöße melden können. Hierzu zählen auch Beamte, Personen in arbeitnehmerähnlichen Positionen, Praktikanten und auch Organmitglieder. Vom Schutzbereich sind aber auch alle Personen umfasst, die Gegenstand einer Meldung sind und als potenzielle Zeugen in Betracht kommen.
Der sachliche Anwendungsbereich erstreckt sich zunächst auf alle Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, soweit sie dem Schutz von Leib, Leben oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dienen. Ein Verstoß kann auch ein Verhalten darstellen, dass selbst nicht rechtswidrig ist, aber dem Ziel und dem Zweck der gesetzlichen Regelungen zuwiderläuft und deshalb als missbräuchlich anzusehen ist.
Erfasst durch das Hinweisschutzgesetz sind nur Verstöße durch Handlungen im Rahmen einer beruflichen unternehmerischen oder dienstlichen Tätigkeit. Der Hinweisgeberschutz gilt zudem für alle Branchen und in allen Betrieben und Einrichtungen, sofern keine sondergesetzlichen Regelungen bestehen oder soweit aus der Natur der Beschäftigung ein vorrangiges Sicherheitsinteresse zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen ist im Rahmen einer Meldung erlaubt, wenn die hinweisgebende Person hinreichenden Grund zur Annahme hatte, dass die Offenlegung zur Aufdeckung eines Verstoßes erforderlich ist und die gemeldete Information der Wahrheit entspricht.
Einrichtung einer Meldestelle
Das Hinweisgeberschutzgesetz sieht externe und interne Meldestellen vor, wobei diese gleichberechtigt nebeneinander stehen. Der Hinweisgeber kann sich frei entscheiden, an welche Meldestelle er sich zunächst wendet, wobei allerdings die interne Meldestelle priorisiert werden soll. Eine gesetzliche Verpflichtung, sich zunächst an die interne Meldestelle zu wenden, gibt es aber nicht. Wird einem intern gemeldeten Verstoß nicht abgeholfen, so kann sich der Hinweisgeber zusätzlich auch an eine externe Meldestelle wenden.
Die externen Meldestellen werden durch den Bund beim Bundesamt für Justiz gebildet, aber auch bei der BaFin und dem Bundeskartellamt. Darüber hinaus haben die Länder die Möglichkeit, externe Meldestellen einzurichten, die für die jeweiligen Landes- und Kommunalverwaltungen tätig sind.
Neben den externen Meldestellen müssen Unternehmen mit regelmäßig mindestens 50 Beschäftigten oder, unabhängig von der Zahl der Beschäftigten im Finanzdienstleistungssektor tätige Unternehmen, verpflichtend eine interne Meldestelle einrichten. Die Verpflichtung betrifft alle „Beschäftigungsgeber“, also sowohl Unternehmen der Privatwirtschaft, als auch öffentlich-rechtlich organisierte Einheiten. Der Beschäftigungsgeber kann eine oder auch mehrere Personen aus seiner Organisation mit den Aufgaben einer internen Meldestelle betrauen, wobei die Aufgabe einer internen Meldestelle zwingend unabhängig und weisungsungebunden ausgeübt werden muss, Interessenkonflikte sind zu vermeiden. Die mit den Aufgaben einer internen Meldestelle betrauten Personen müssen über die notwendige Fachkunde verfügen. Unternehmen mit in der Regel 50-249 Beschäftigten können auch eine gemeinsame Meldestelle bilden, wobei eine gemeinsame Meldestelle einen Beschäftigungsgeber nicht davon entbindet, selbst geeignete Maßnahmen zur Abstellung eines Verstoßes zu ergreifen.
Mit der Bildung der internen Meldestelle kann das Unternehmen auch einen geeigneten, externen Dritten beauftragen, die Meldestelle muss nicht zwingend im Unternehmen selbst gebildet werden. Um die gebotene Neutralität und Unabhängigkeit der Meldestelle zu wahren, sind allerdings nur solche Dritte geeignet sein, die sich in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen befinden. Bei Beauftragung von Anwälten ist z.B. die Vermeidung von Interessenkonflikten sicherzustellen. Damit scheiden in der Regel diejenigen Rechtsanwälte aus, die ein Unternehmen regelmäßig in anderen Rechtsfragen vertreten.
Die Bearbeitung von eingehenden Meldungen
Der Beschäftigungsgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass Meldungen über einen geeigneten Meldekanal zur internen Meldestelle gelangen. Neben digitalen Schnittstellen sind grundsätzlich alle denkbaren Meldewege geeignet und zulässig, so auch der einfache Briefkasten, die Einrichtung einer Mailadresse und/oder Telefonnummer, etc., da keine gesetzliche Verpflichtung besteht, Meldekanäle für anonymisierte Meldungen vorzuhalten. Gleichwohl sollte der Beschäftigungsgeber die Meldekanäle für den Hinweisgeber so komfortabel ausgestalten, dass auch in der Praxis eine Priorisierung der internen Meldestelle stattfindet, ggf. unter Einbeziehung eines anonymisierten Meldekanals.
Die Anforderungen an die externen und internen Meldestellen sind bei Eingang einer hinweisgebenden Meldung gleich:
Der Eingang einer Meldung ist von der Meldestelle zu dokumentieren und dem Hinweisgeber innerhalb von 7 Tagen zu bestätigen. Bei Abgabe einer anonymen Meldung entfällt naturgemäß die Kommunikation mit der hinweisgebenden Person. Die Meldestelle prüft zunächst, ob die Meldung in den Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes fällt und alle Anforderungen erfüllt sind. Anschließend soll die Meldestelle angemessene Folgemaßnahmen ergreifen und dazu beitragen, etwaige Verstöße abzustellen, wobei das HinSchG hierzu keine konkreten Vorgaben macht. Möglich ist insoweit die Durchführung von eigenen Ermittlungen oder die Abgabe an externe Ermittlungsbehörden. In jedem Fall soll die Meldestelle in der Wahl der Folgemaßnahmen unabhängig und weisungsungebunden sein.
Der Hinweisgeber muss von der Meldestelle spätestens nach 3 Monaten eine Rückmeldung zu seiner Meldung erhalten und von dieser über bereits ergriffene und geplante Folgemaßnahmen unterrichtet werden. Eine Mitteilung über geplante Folgemaßnahmen kann unterbleiben, wenn diese durch die Offenlegung gefährdet werden würden.
Die Meldestelle unterliegt in jedem Fall dem Vertraulichkeitsgebot. Die Weitergabe von Informationen zum Hinweisgeber ist in Regel nur mit dessen Zustimmung zulässig, Informationen zu Personen, die Gegenstand der Meldung oder der Folgemaßnahmen sind, nur dann, wenn es für die Folgemaßnahmen zwingend erforderlich ist.
Schutz des Hinweisgebers
Der Schutz des Hinweisgebers nach einer Meldung ist einer der Schwerpunkte des Hinweisgeberschutzgesetzes. Der Hinweisgeber wird durch das Gesetz umfassend vor Nachteilen geschützt, die ihm auf Grund seiner Meldung drohen.
Hierzu ist die Meldung des Hinweisgebers zwingend vertraulich zu behandeln, insbesondere gegenüber Personen, die Gegenstand der Meldung sind. Alle Informationen, die Rückschlüsse auf den Hinweisgeber zulassen, sind geheim zu halten, auch nach Abschluss der erforderlichen Ermittlungen.
Der Hinweisgeber wird durch das Hinweisgeberschutzgesetz umfassend vor Repressalien jeglicher Art als Reaktion auf seine Meldung geschützt, wobei das Hinweisgeberschutzgesetz keinen abschließenden Katalog möglicher Repressalien enthält. Als Repressalie ist vielmehr jede denkbare berufliche Benachteiligung zu verstehen, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Meldung des Hinweisgebers steht. Das Gesetz vermutet zu Gunsten des Hinweisgebers, dass jede, im Zusammenhang mit einer Meldung erlittene berufliche Benachteiligung ursächlich auf die Meldung selbst zurückzuführen ist. Es obliegt dann dem Arbeitgeber nachzuweisen, dass zwischen einer Benachteiligung und einer Meldung kein Zusammenhang besteht, die Benachteiligung vielmehr andere Gründe hat. Der Hinweisgeber muss sich auf den Einwand, dass eine Benachteiligung eine Repressalie nach erfolgtem Hinweis darstellt, aktiv berufen, andernfalls bleibt dieser Einwand unberücksichtigt. Der umfassende Schutz vor beruflichen Nachteilen soll nur dann nicht gelten, wenn der Hinweisgeber selbst an dem gemeldeten Verstoß beteiligt ist.
Repressalien gegenüber einem Hinweisgeber sind mit einem Bußgeld bewehrt, dem Hinweisgeber steht zudem ein Schadenersatzanspruch gegen den Verursacher einer Repressalie zu.
Umsetzungsfristen
Die Verpflichteten mussten die interne Meldestelle 1 Monat nach Verkündung des Gesetzes (Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt) einrichten. Für private Beschäftigungsgeber mit in der Regel 50 bis 249 Beschäftigten gilt abweichend davon eine Einrichtungsfrist für die interne Meldestelle bis zum 17. Dezember 2023. Die verlängerte Einrichtungsfrist gilt nicht für Finanzdienstleister, unabhängig von der jeweiligen Beschäftigungszahl.
Fazit
Nachdem der Gesetzesentwurf im Februar noch im Bundesrat gescheitert ist, wurde das Hinweisgeberschutzgesetz mit seinen Pflichten für öffentliche und private Beschäftigungsgeber im Mai 2023 verabschiedet. Die notwendigen, durch die Unternehmen zwingend umzusetzenden Vorgaben, insbesondere zur Einrichtung einer internen Meldestelle, sind umfangreich, die Umsetzungsfrist ist bereits abgelaufen. Die Nichteinrichtung einer internen Meldestelle wird ab dem 01.12.23 mit einem Bußgeld geahndet. Für Unternehmen mit regelmäßig 50-249 Beschäftigten läuft die Einrichtungsfrist mit dem 17.12.23 ab.